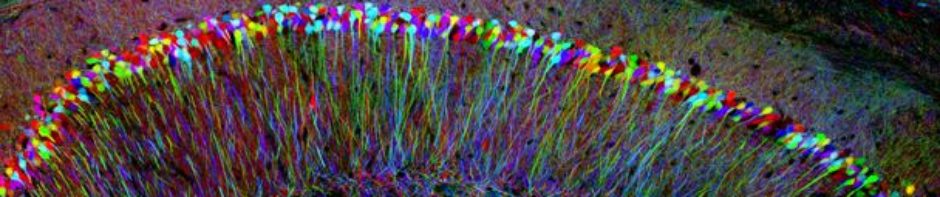Sechs Tage, 25000 Teilnehmer, 13500 Abstracts. Hinter diesen beeindruckenden Zahlen steckt die US-amerikanische Society for Neuroscience, die auch bei ihrem 30. Jahrestreffen gezeigt hat, dass die Begriffe „Masse“ und „Klasse“ durchaus vereinbar sein können. „Alle beschweren sich über die Größe des Meetings“, räumt der scheidende Präsident. Dennis Choi von der Washington University in St. Louis, ein. Und die Meisten sind genau deshalb zu „Stammgästen“ dieser Tagung geworden, ließe sich hinzufügen. Denn nirgendwo sonst wird Neurowissenschaftlern eine solche Themenvielfalt geboten. Wie Tauben den Weg nach Hause finden und mit welchen Nervenzentren die Schaben Madagaskars die Zischlaute ihrer Artgenossen empfangen, wurde ebenso diskutiert wie die neuesten Theorien der Bewußtseinsforscher oder High-Tech-Methoden zur holographischen Darstellung von Nervengeflechten.
Im Vordergrund standen jedoch gleichermaßen zukunftsträchtige wie medizinisch relevante Themen. Hunderte von Vorträgen waren alleine den Stammzellen gewidmet. Dass diese oftmals nur unscharf definierten biologischen Verwandlungskünstler schon bald als Ausgangsmaterial für eine Vielzahl klinischer Studien dienen werden, war die Conclusio, die in fast jeder Session mit großer Überzeugung vorgetragen wurde. Zwar handelte es sich bei den vorgestellten Arbeiten mit wenigen Ausnahmen um Tierversuche. Dennoch belegen Dutzende von Experimenten an Mäusen, Ratten und auch Affen die Reparatur der unterschiedlichsten Nervenschäden.
Erstmals konnte beispielsweise Tracy McIntosh vom Head Injury Center der University of Pennsylvania zeigen, dass embryonale neuronale Stammzellen bei erwachsenen Tieren die Erholung motorischer Funktionen nach traumatischen Hirnverletzungen beschleunigen. Evan Snyder von der Harvard Medical School präsentierte alleine ein halbes Dutzend Arbeiten, wonach die Stammzellen sogar die Fähigkeit besitzen, nach einer Injektion beispielsweise am Hinterkopf weite Strecken bis zum Läsionsort im frontalen Cortex zu wandern und die Schäden zu lindern. Bei einem Rattenmodell des Schlaganfalls reduzierte die Kombination aus Stammzellen und Nervenwachstumsfaktor (NGF) den Zellverlust um 20 Prozent, bei einem Modell der amyotrophen Lateralsklerose verlängerte sich die Überlebenszeit der Tiere von etwa zwei auf sechs Monate und bei experimentellen Glioblastomen erzielte Snyder eine hochsignifikante Reduktion der Tumormasse. Ein weitere mögliche Anwendung zeigte Jeffrey Rothstein von der Johns Hopkins University in Balitmore auf, dem es gelang, die Bewegungsfähigkeit vollständig gelähmter Ratten und Mäuse teilweise wieder herzustellen, indem er den Tieren eine Woche nach der virusinduzierten Läsion Stammzellen in den Spinalraum spritzte.
Im Mittelpunkt zahlreicher Vorträge standen die „Rezepte“, nach denen Stammzellen Wachstumsfaktoren gegeben oder entzogen werden müssen, um im Labor größere Mengen spezifischer Neuronen oder Gliazellen für Transplantationszwecke zu gewinnen. So gelang einem Team um Ron McKay am Labor für Molekulare Biologie des National Institute for Neurological Disorders and Stroke nicht nur die Zucht dopaminerger Neuronen aus embryonalen Stammzellen der Maus. Nach der Transplantation dieser Zellen in die Substantia nigra erwachsener Tiere konnte McKay auch funktionelle Verbindungen zu präexistenten Neuronen nachweisen, die mit einer deutlichen Verringerung der Bewegungsstörungen bei den vorgeschädigten Versuchstieren einher gingen.
„Wenn uns dieser Schritt auch mit menschlichen Zellen gelänge, so stünde damit eine unerschöpfliche Quelle von Nervenzellen für die Transplantation bei Parkinson-Kranken bereit“, erläuterte McKays Mitarbeiterin Nadya Lumelsky. Tatsächlich hat einer der Pioniere auf diesem Gebiet, Anders Björklund von der schwedischen Universität Lund, bereits angekündigt, er wolle mit derartigen Zellinien die in seinem Land erfolgreich praktizierte Transplantation embryonaler Zellen aus abgetriebenen menschlichen Embryonen überflüssig machen. Neben den vielen technischen Schwierigkeiten bei der Gewinnung dieser Gewebe ließen sich so auch die ethischen Probleme überwinden, die eine Anwendung der Technik in Deutschland bislang verhindert haben.
Vielleicht wird die Ethikkommission der Bundesärztekammer ein entsprechendes Votum aber auch nochmals überdenken müssen, nachdem in New Orleans gleich zwei Arbeitsgruppen über die erfolgreiche Transplantation humaner Fötalzellen aus Patienten mit Chorea Huntington berichtet haben: Marc Peschanski vom INSERM-Forschungsinstitut in Creteil bei Paris stellte zwei Jahre nach der Operation steht fest, dass lediglich einer von fünf Patienten nicht von dem Eingriff profitierte. Bei den anderen sah Peschanski zum Teil drastische Verbesserungen. „Die praktische Relevanz zeigt sich daran, dass die Patienten bereits verloren gegangene Fähigkeiten wieder erlangten: Sie können zum Beispiel wieder Fahrrad fahren oder Gitarre spielen.“ Der Star der Studie sei ein Patient gewesen, der sich auf der Bewertungsskala UHDRS (Unified Huntington´s Disease Rating Scale) von 28 auf 13 verbessert hat. „Vorher konnte er nicht einmal auf einem Stuhl sitzen, zwei Jahre später sind seine Behinderungen bis auf gelegentliche Zuckungen im Gesicht verschwunden“, übersetzte der Neurochirurg den Befund.
Auch Thomas B. Freeman, Professor für Neurochirurgie an der University of South Florida, konnte die ersten Daten zu fünf transplantierten Huntington-Patienten vorlegen. Einer erlitt eine Subdural-Blutung; bei den anderen vier aber hätten sich die Bewegungsstörungen um durchschnittlich 20 Prozent verringert, das Geh- und Balancevermögen um etwa sieben Prozent verbessert und die Aufnahme des Botenstoffes Dopamin in den transplantierten Hirnregionen um etwa neun Prozent zugenommen. „Dies macht Hoffnung auf eine Reparatur der Hirnfunktion bei Huntington-Kranken“, erklärte der Mediziner.
Neben der „harten Wissenschaft“ konnte man in New Orleans auch einiges über die innersten menschlichen Regungen dazu lernen. So gelang es Andreas Bartels vom University College London das „neuronale Korrelat der romantischen Liebe“ dingfest zu machen. Der schweizerische Doktorand in der Arbeitsgruppe von Seymour Zeki hatte 17 Freiwillige, die nach eigenen Angaben „wahnsinnig verliebt“ („truly and madly in love“) waren, zur kernspintomographischen Untersuchung gebeten. Dort präsentierte Bartels den Studienteilnehmer entweder Porträts ihrer Herzallerliebsten oder Bilder von guten Freunden gleichen Alters und Geschlechts. Die anschließende Auswertung ergab, dass regelmäßig nur vier eng begrenzte Regionen des Gehirns beim Anblick des Geliebten aktiv wurden: es handelt sich dabei um Teile der medialen Insula und des anterioren Cingulus der Großhirnrinde, sowie um tiefer liegende Arealen des Nucleus caudatus und des Putamens. All diese Hirnregionen waren bereits früher von anderen Wissenschaftlern mit Emotionen und Glücksgefühlen in Zusammenhang gebracht worden. Beispielsweise gehört der von Bartels identifizierte Teil des Putamen zu einer viel größeren Zone, in der der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird, wenn Testpersonen bei einem Videospiel erfolgreich sind. Auch liegen alle „Liebesareale“ in Bereichen des Gehirns, die nach der Einnahme von Drogen wie Kokain aktiv werden.
Die unvermeidlichen Fragen der Journalisten nach der praktischen Bedeutung seiner Erkenntnisse konterte der Jungforscher souverän: „Jetzt wissen wir, welche Hirnteile man bei unglücklich Verliebten entfernen muss“. Außerdem werde man in Zukunft den Wahrheitsgehalt von Liebesschwüren mit Hilfe eines Kernspintomographen überprüfen können, scherzte Bartels.
Weitere Informationen: