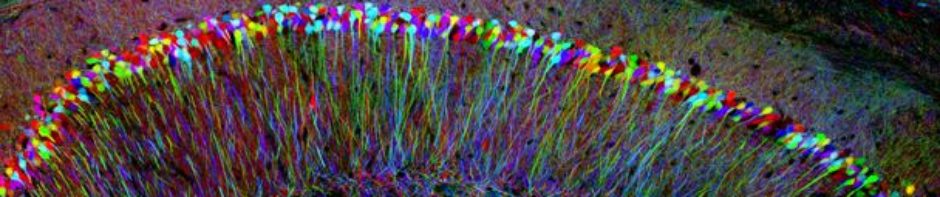Das Zittern und Zappeln seiner Patienten kann Andries Bosch hervorragend imitieren: Wie eine Marionette an den Fäden eines ungeschickten Puppenspielers bewegt sich der Neurochirurg durch den Raum, um plötzlich wieder in einen normalen, entspannten Gang zu verfallen. „So sieht es aus, wenn ich den Schalter umlege und das Gehirn elektrisch stimuliere”, beschreibt der Niederländer das spektakuläre Ergebnis des Eingriffes, den er schon Dutzende Male an der Universität Amsterdam durchgeführt hat.
Meist sind es ältere Menschen im fortgeschrittenem Stadium der Parkinson-Krankheit, die von der sogenannten Tiefhirnstimulation profitieren, erklärte Bosch auf dem 8. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Stereotaktische und Funktionale Neurochirurgie, der kürzlich in Freiburg stattfand. Etwa ein Viertel aller Vorträge waren der Tiefhirnstimulation und ähnlichen Techniken gewidmet. Das starke Interesse überrascht Bosch nicht im geringsten: „Bis zu 80 Prozent aller Patienten könnten von diesen Eingriffen profitieren, wenn sechs bis acht Jahre nach Beginn des Leidens die Medikamente ihre Wirkung verlieren.” Probleme gibt es allerdings noch mit den Krankenkassen. In den Niederlanden ebenso wie in Deutschland weigern sie sich derzeit noch, die Kosten von etwa 15000 Mark zu erstatten. Doch das wird sich ändern, wenn Bosch mit seiner derzeit laufenden Studie Erfolg hat. Videoaufnahmen, die 70 Patienten, mit „Zitterkrankheiten”, Parkinson oder Multipler Sklerose jeweils vor und nach der Operation zeigen, sollen zusammen mit verschiedenen Bewertungssystemen den Beweis erbringen, daß die Tiefhirnstimulation auch unter finanziellen Gesichtspunkten eine sinnvolle Methode darstellt.
Die Chancen dafür stehen gut, weiß Bodo-Christian Kern, Oberarzt am Universitätsklinikum Benjamin Franklin (UKBF) der Freien Universität Berlin. Zwar wurde die High-Tech-Operation, bei der dem Patienten eine Elektrode ins Gehirn implantiert wird, erst kürzlich von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA genehmigt. In Europa hat man damit jedoch schon seit 1989 Erfahrungen gesammelt.
Allein acht Zentren in Deutschland verfügen über das nötige Know-how, darunter die Universitätskliniken in Heidelberg, Köln, Homburg an der Saar und München. Weltweit, schätzt Kern, wurden bisher rund tausend Parkinsonkranke mit der neuen Methode behandelt. 50 bis 60 dieser Patienten erhielten die Therapie in Berlin an der Neurochirurgischen Klinik des UKBF, die Kerns Chef, Mario Brock, leitet. Die Erfolgsquote des neuen Verfahren, berichtet Kern, liegt bei 80 bis 85 Prozent. Bei anderen Zitterkrankheiten seien es sogar 90 Prozent.
Durch ein kleines Loch in der Schädeldecke schieben die Ärzte während der Operation vorsichtig eine Elektrode in eines jener Nervenzentren, deren Schädigung Zittern, Zuckungen und Muskelsteife verursachen kann. Anders als beim einfachen Zittern (Tremor), bei dem in der Regel das Zwischenhirn Ziel der Operation ist, steuern die meisten Arbeitsgruppen bei ihren Parkinsonpatienten tiefer liegende Hirnregionen an. Zu diesen zählen der sogenannte Globus pallidus im Endhirn sowie der Nucleus subthalamicus. Die erbsengroßen Nervenknoten sind beide an der Feinsteuerung von Bewegungen beteiligt.
Während der Operation müssen sich die Chirurgen quasi blind zu ihrem Ziel vortasten. Zwar kartieren Neuroradiologen das Operationsgebiet zuvor mit Hilfe modernster bildgebender Verfahren. Die Feinortung im Hirn des Patienten können die Mediziner jedoch nur gemeinsam mit dem Kranken vornehmen: Bei vollem Bewußtsein muß er während des Eingriffs auf Zuruf einen Finger, die Hand oder den Arm bewegen, bis die Ärzte zum richtigen Hirnareal vorgedrungen sind. Unter Vollnarkose wird schließlich ein Stimulator vom Format eines größeren Feuerzeugs unterhalb des Schlüsselbeins implantiert und mit der Elektrode im Kopf verbunden. Nach der Operation stellt der Arzt Stromstärke und Frequenz der Schrittmacher-Impulse individuell auf den Kranken ein. Mit einem Magneten kann der Patient seinen Hirnschrittmacher später nach Belieben einschalten, sobald das Zittern beginnt. Die elektrischen Impulse bringen die Zuckungen sofort zum Stopp.
Kommt es durch die Operation trotz aller Vorsicht zu Problemen – etwa zu einem Taubheitsgefühl in der Hand – bleibt als letzte Möglichkeit noch immer: Abschalten. Diese Option ist für Kern der Hauptvorteil der Tiefhirnstimulation gegenüber der fast 50 Jahre alten Pallidotomie. Auch bei dieser wird dem Patienten eine Elektrode ins Gehirn eingeführt – doch nur für die Dauer der Operation. Der Draht dient hierbei dazu, ein etwa linsengroßes Stück Gewebe im Zwischenhirn regelrecht zu verbrennen. Spezialisten wie Christoph Ostertag von der Universität Freiburg haben die Pallidotomie in den vergangenen Jahren ständig verfeinert und haben damit bereits große Erfahrung, die bei der noch jungen Hirnschrittmacher-Methode fehlt. Die Methode ist laut Ostertag wesentlich billiger und erspart entfernt lebenden Patienten den Weg in die Spezialklinik zur Nachjustierung des Stimulators. Der Trend in der Neurochirurgie gehe jedoch seit einigen Jahren weg vom Zerstören, das immer irreversibel ist, hin zur Stimulation von Hirnzentren, die man jederzeit beenden wieder kann, sagt Kern.
Der Oberarzt des Berliner Universitätsklinikums räumt aber ein, daß auch die Tiefhirnstimulation Risiken mit sich bringt. Bei vier Prozent der Eingriffe entstünden im Gehirn größere Verletzungen an Blutgefäßen, die ähnliche Folgen haben wie ein kleiner Schlaganfall. Viele Patienten würden diese Gefahr bereitwillig in Kauf nehmen. Doch auch in Berlin verweigern die Krankenkassen die Kostenerstattung, so daß die Stimulatoren derzeit noch aus der Klinikkasse bezahlt werden müssen. Kern empfindet dies als große Ungerechtigkeit, da Medikamente täglich bis zu 10 Mark kosten und anstandslos erstattet werden. Dabei sei die Wirkung der Substanzen von begrenzter Dauer. Denn sie können zwar den Botenstoff Dopamin ersetzen, nicht jedoch seine Empfängerzellen in der winzigen Hirnregion Substantia nigra, die im Verlauf der Krankheit absterben.
Möglicherweise werden sich jedoch Stoffe wie der gentechnisch hergestellte Wachstumsfaktor GDNF, den Forscher derzeit in klinischen Studien testen, besser bewähren. Er soll den Tod der Hirnzellen verzögern. Gleichzeitig arbeitet man daran, Nervenzellen von Verstorbenen oder von Tieren im Labor auf die Produktion von GDNF und ähnlichen Substanzen zu programmieren. Die Zellen sollen dann ins Gehirn von Patienten verpflanzt werden und dort als lebende Arzneifabriken dem Verfall entgegenwirken. Bis es jedoch soweit ist, sind Hirnschrittmacher neben der Pallidotomie die einzige Alternative für die etwa 280 000 Parkinsonkranken hierzulande. Von den Elektroden im Kopf profitieren sie mindestens zwei Jahre, wie die wenigen bisher veröffentlichten Studien zeigen – vielleicht sogar länger.
Weitere Informationen: